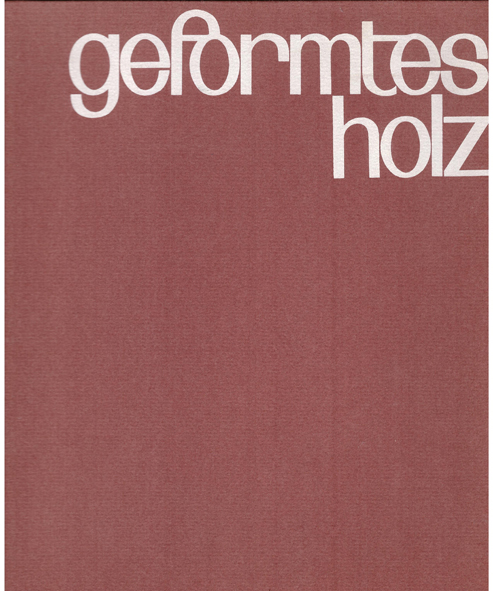Fortsetzung Teil 2
4
Moden sind weniger kulturelle als kommerzielle Erscheinungen. Moden werden gemacht, mit dem handfesten Ziel, sie zu verkaufen. Ein durchaus ehrbares Ziel. Moden sind erträglich, können zierlich und erfreulich sein, solange sie sich nicht als Kunst geben, solange sie nicht vorgeben, ein anderes als das kommerzielle Ziel zu haben. (Dass in einer vernünftigen Gesellschaft nur derjenige sein kommerzielles Ziel erreicht, der Gutes, Preiswertes liefert, setzt der Mode Grenzen. Dass andererseits der Kollektiv-Vernunft Grenzen gesetzt sind, begünstigt Eskapaden und Extravaganzen der Moden).
Das Entstehen von Moden des Möbels, des Wohnens, hat seine Voraussetzungen: In der Wirtschaftsform (vom Merkantilismus bis zur sozialen Marktwirtschaft), in der Gesellschaft (vom zunehmend egalisierten, traditionslosen, kaufkräftig werdenden Bürgertum bis zur pluralistischen Gesellschaft), in der Produktion (von der teilmaschinellen Handwerksfertigung zur vollautomatischen Serienproduktion), in der Kommunikation (von den Anfängen des internationalen Verkehrs bis zu den Massenmedien Rundfunk und Fernsehen), im gesellschaftlichen Leitbild (von Madame Recamier bis Brigitte Bardot).
Vor den Ludwigs in Frankreich konnte es deshalb Möbel-Moden im heutigen Sinne, nach den Ludwigs Möbel-Stile im alten Sinne nicht mehr geben. Die Louis-Stile, von XIII bis XVI, waren der Übergang, sie waren – im Gegensatz zur bürgerlich-kirchlichen Gotik und zur bürgerlich-weltlichen Renaissance – schon so etwas wie höfische Privat-Moden, mit wachsendem Einfluss nach außen, nach unten. Die Architektur, die in Gotik und Renaissance die Möbelformen und Möbeldekors prägte, verlor ihren Einfluss: der Schreiner hatte sich vorn Zimmermann getrennt, spezialisierte sich auf Möbel, verfeinerte seine handwerkliche Fertigkeit zur Kunstfertigkeit. Verbesserte Werkzeuge, verbesserte Bearbeitungstechniken machten Neues möglich: das theatralische Barock hätte gültige Möbel ohne die Kunst des Furnierens wohl nicht gefunden.
Das repräsentative Element, in Mittelalter und Antike zweckgebunden, befreite sich nun, in der Renaissance beginnend, machte sich selbständig, wurde ohne Bindung zügellos, inhaltslos, zur bloßen Spielerei. Die feierliche Repräsentation wurde zum aufdringlichen Protz, zur Angabe degradiert. Kommende Moden kündeten sich an. Die Form triumphierte, wurde auto-nom, unterdrückte, erdrückte zuweilen die Funktion: auf toskanischen Stühlchen des 17. Jahr-hunderts ist ein rechtes Sitzen kaum möglich. Man sollte sich ja auch nicht darauf setzen. Der Stuhl war Schmuck-, nicht Zweckgegenstand. Nicht überall allerdings zu jener Zeit: England hat solche Barock-Eskapaden kaum erlebt; der elisabethanische Stuhl war renaissance-beeinflusst wie der georgianische des 17. Jahrhunderts und die Stühle Chippendales und Sheratons im 18. Jahrhundert. Puritanische Einfachheit, schlichtes understatement galten dem Gentleman als Merkmal des Vornehmen. Auf dem Kontinent imitierte das Empire im Stil ä l'anglaise das Schlichte, Kahle, aber auf kalt-protzige Art.
Im kontinentalen Europa hielten sich die lokalen Stil- und Mode-Unterschiede von der Renaissance bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. Es wäre niemandem in den Sinn gekommen, einen Louis-Treize-Stuhl zu exportieren, zu imitieren. (Obwohl Ludwig XIII., wie Mazarin, mit Leidenschaft ausländische, vor allem italienische Möbel sammelte.) Der Privat-Mode fehlte – zunächst – das kommerzielle Ziel. Erst das Louis-Quartorze gab in Europa den Ton an.
Colbert gründete 1667 für Ludwig XIV. die „Manufacture royale des meubles de la Couron-ne“, hofeigene Möbelfabriken, in denen Louis XIV. und sein Hofmaler Charles Lebrun ihre Idee von einem neuen Stil in die Tat umsetzten: ein erst dem Merkantilismus mögliches Unter-nehmen. Die bedeutendsten schöpferischen Kräfte der Nation wurden in den Dienst der Idee gestellt. Ziel war das Möbel als Kunstwerk. Der Möbelschreiner, der Ebenist, erreichte unter Ludwig XIV. den Rang des Künstlers. Charles-Andre Boulle war „architecte, peintre, sculptur en mosaïque, ébeniste, ciseleur, marqueteur“. Holzfremde Materialien – Kupfer, Zinn, Knochen, Horn, Elfenbein, Perlmutter – wurden mit dem Holz verarbeitet, in das Holz eingelegt. Die Konstruktion, am gotischen Möbel hauptsächliches optisches Merkmal, trat hinter die Dekoration zurück. Das Raffinement wurde – gegen Ende des 17. und zu Beginn des 18. Jahrhundert vor allem – auch auf Kosten der Qualität gepflegt: auf Boulle-Möbeln lösten sich die Marketerien aus Schildpatt oft unter dem Einfluss feuchter Wärme.
Noch aber war eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Ausbreitung einer Mode nicht gegeben: Das Bürgertum Frankreichs war seit den Glaubenskriegen verarmt und durch die katastrophale Finanzpolitik Ludwigs XIV. noch mehr ausgepovert; in Deutschland wirkten die Folgen des Dreißigjährigen Krieges auf das Volk während des ganzen 17. Jahrhunderts nach. Erst in der zweiten Hälfte des 18. und im 19. Jahrhundert, gekoppelt an Aufklärung und Kapitalismus, stieg das Bürgertum auf. Unter der R6gence Philippe d'Orl6ans um 1720 prägte sich – wenn man es zeitlich fixieren will – die Trennung zwischen höfischen und bürgerlichen Möbeln. Eine weitere Voraussetzung für Moden war damit gegeben: die Möbel staffelten sich nach gesellschaftlichem Rang, nach dem Einkommen. Jetzt konnten die Imitationen, das Halbechte, der Kitsch grassieren: Philippe-Claude Montigni imitierte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Boulle-Möbel in Massen und fand seine Käufer in ganz Europa, so wie heute Fabriken Louis-QuinzeMöbel in Serien herstellen.
Alle Voraussetzungen waren erfüllt: die Moden konnten kommen. Und sie kamen zuhauf, im 18., vor allem aber im 19. Jahrhundert. Es ist müßig, sie einzeln aufzuführen, sie zu beschrei-ben; sie sind bereits ausreichend katalogisiert. Ihr Typisches ist die Äußerlichkeit, ihre Ein-flüsse sind wesensfremd: die Archäologie, das Hobby des 18. Jahrhunderts, bestimmte das Möbeldekor wie einst die Architektur, die Reisen des Comte de Cailus nach Griechenland, Italien und Kleinasien hatten größere Wirkung auf die Schreinerei als die Erkenntnis, dass die Stühle am Menschen gemessen werden sollten. Und doch: die Sitzmöbel bekamen in dieser Zeit zum erstenmal „menschlichere“ Maße; Commodité, Bequemlichkeit, wird zur Forderung. Dass der Stuhl im aufgehenden Zeitalter der Industrialisierung – etwa im Büro – eine neue Aufgabe erhält, schlägt sich immerhin in der Erfindung des „Fauteuils de bureau“, einer Art Kombination aus Kamelsattel und dackelbeinigem Sessel, und des „Fauteuil de bureau tournant“, des Drehstuhls, nieder.
Nur einmal noch erlebte das Wohnen einen – sagen wir – stillen Höhepunkt: im viel ge-schmähten, viel heimlich geliebten Biedermeier. Das Schreinerhandwerk – seit der Aufhebung der Zunftordnungen 1792 zerfallend – erlebte eine Spätblüte, baute die besten Möbel des Jahrhunderts. Die Meisterschaft biedermeierlicher Stuhlmacherkunst war überragend. Noch einmal fanden sich technische Möglichkeiten der Holzbearbeitung, Funktionen und Formen der Möbel in einer Synthese, die der Zeit entsprach. Es war die zweite, die letzte Blüte privaten, bürgerlichen Lebens seit dem Mittelalter. Und eine der wenigen Zeiten in der Geschichte des Möbels, in denen die letzten technischen Möglichkeiten ganz in den Dienst der Funktionen des Möbels gestellt wurden.
Zur Apologie der Stuhlmacher aber sei gesagt, dass, über die Zeit gesehen, das Material Holz und seine in Jahrtausenden verbesserten Bearbeitungsmethoden die Formen des Sitzmöbels nachhaltiger prägten als alle sekundären Einflüsse, so sehr diese auch zeitweilig die Oberhand gewinnen mochten. Und schließlich hätten sich all die Nebensächlichkeiten nicht auf den Sitzmöbeln austoben, hätten die Stuhlformen nicht die Vielfalt erreichen können, wenn handwerkliche Fertigkeit nicht den Fortschritt etwa vom Brettstuhl zum Zargenstuhl ermöglicht hätte.
5
Jedes Material hat seine spezifischen Eigenschaften. Sie bestimmen Art und Grenzen seiner Verarbeitung. Materialgerecht nennen der Praktiker und der Theoretiker Formen, die diesen Eigenschaften angemessen sind und sie zum Vorteil nützen, Formen, die sich in den Grenzen halten, die der Verarbeitung gesetzt sind. Aber diese Grenzen fließen; neue Werkzeuge, neue naturwissenschaftliche Erkenntnisse verschieben sie, vergrößern den Raum der Möglichkeiten. Was gestern materialfremd war, kann heute materialgerecht sein, was der Kanon des Handwerks einst verdammte, kann in der Serienproduktion technische Notwendigkeit sein. Die Vorstellung von materialgerechter Form muss deshalb, soll sie nicht hemmend wirken, frei sein von dogmatischen oder romantischen Einflüssen.
Holz ist, neben Stein, das Material, das der Mensch zuerst formte. Das Jung-Paläolithikum war ebenso ein Paläolignikum. Schon der Mensch der letzten Eiszeit, vor dreißigtausend Jah-ren, baute, bevor er dauernd sesshaft wurde, architektonisch klar durchdachte Unterkünfte: regelrechte Hausbauten. Wände und wohl auch Böden dieser Häuser wurden aus Holz gebaut; die Konstruktion war vermutlich verzapft, gebunden oder durch die Zwischen- und Stirnwände verkeilt.
Der Jung-Paläolithiker konnte also das Holz bereits in Teile zerlegen und diese Teile wieder fest zusammenfügen. (Holz, aus germanisch „holtaz“, bedeutet ursprünglich „Abgeschnittenes, Gespaltenes“). Klingen, Schaber, Bohrer waren seine Werkzeuge, vielleicht auch schon der Fidelbohrer, durch den Jagdbogen angetrieben; die erste Werkzeugmaschine also. Auch Sägen, Messer, Hobel, Stichel und Beile formte er aus Stein und Knochen.
Seinen Sitz baute sich der Jung-Paläolithiker wohl aus Stein oder schnitt ihn aus dem Erdreich und belegte ihn mit Holz. In der Jungsteinzeit konstruierte er sich die Bank aus Holz, zunächst nicht als Sitzmöbel, sondern als Schlafstatt. Das Freilichtmuseum auf der Mettnau bei Radolfzell zeigt Rekonstruktionen jungsteinzeitlicher Wohnungen, mit Bänken und Tischen in Brettstuhl-Konstruktion: die vier schräg gestellten Beine sind in das Sitzbrett, in das Tischbrett eingezapft. Auch Natursitze, hackblock-ähnliche Stücke aus Baumstämmen, finden sich noch.
Diese frühesten Formen und Arten ergaben sich aus den elementaren Bedürfnissen, den Maßen des Menschen, dem Material und den vorhandenen Werkzeugen; sie konnten nicht anders als funktions- und materialgerecht sein für damalige Umstände. Materialgerecht, funktionsgerecht sind zeitbezogene Begriffe.
Der Schritt war groß: Das erste unbeholfene Bearbeiten eines Holzblocks mag zufälliger Er-fahrung gefolgt sein; das Zerteilen des Holzblocks in brauchbare Stücke, das anschließende Zusammenfügen der Teile zum Gerät erfordert bereits vorausplanendes Denken. (Man könnte – cum grano salis – behaupten, das technische Vermögen des Menschen lasse sich messen an seiner Fähigkeit, Dinge in immer kleinere Teile zu zerlegen und die Teile zu neuen Dingen wieder zusammenzufügen). Es war der Schritt vorn Hand-Werker zum Köpf-Werker, vorn Manufakturisten zum Ingenieur. Nicht nur unvollständig, unmöglich wäre der Schritt gewesen ohne neues Werkzeug – Säge, Beil –, ohne die Erfindung, Holzteile durch Verzahnen, Verzapfen, Verkeilen miteinander zu verbinden.
Verbesserung war das Ziel; die Auseinandersetzung zwischen Material und Werkzeug, vom Menschen gelenkt, erreichte es. Der Wunsch, das Sitzgerät zu verbessern, traf aber nicht immer, sogar in den meisten Fällen nicht die eine ursprüngliche Funktion: dem Menschen einen bequemen, erholsamen Sitz zu bieten. Diese Funktion erfüllte der erste, der primitive Natursitz in einer vollendeten Weise, die ohne neue Materialien, ohne wissenschaftliches Denken nicht zu verbessern war. Der Drang zur Änderung, zum Neuen traf deshalb zunächst andere Funktionen des Sitzgerätes, ja, schuf diese erst: die Beweglichkeit, die das Sitzgerät zum Sitzmöbel macht, oder die schmückende Form, das Dekor.
Es ist zu bezweifeln, ob die erste selbstkonstruierte Bank des Menschen bequemer war als sein Natursitz, aber sie war gewiss beweglicher, mobiler; sie ließ sich den wechselnden Bedürfnissen anpassen: Essplatz, Ruhesitz am Tage, Schlafstatt in der Nacht. – Die erwünschte Beweglichkeit hat die Form des Sitzmöbels zuerst und mit der Zeit entscheidend mitbestimmt: Falt-, Klapp-, Scherenstühle entstanden, weil Wohnräume in Antike und Mittelalter so eng waren, dass unbesetzte Stühle beiseite gestellt werden mussten.
Der Klappstuhl ist der beweglichste, der am meisten mobile Stuhl. Er ist zugleich einer der ältesten, uns bekannten Stuhltypen, überliefert aus dem alten Ägypten, aus Griechenland, Rom, dem Mittelalter, der Renaissance – bis zur Neuzeit: nicht nur als Gartenstuhl lebt er weiter. Die Forderung nach Beweglichkeit des Stuhles ließ den Menschen zu einer Zeit, da er noch primitive Kisten- und Brettsitze bastelte, den – nicht in der Konstruktion, aber im Entwurf – verhältnismäßig komplizierten Faltstuhl bauen; er setzte physikalische Kenntnisse voraus, seine Konstruktion ist von Anfang an technisch und formal vollendet; griechische Darstellungen des Diphros auf Vasenbildern zeigen es: etwa auf dem Kelchkrater des Euphronius oder auf einer apulischen Amphora die heute im Nationalmuseum in Neapel steht.
Die Form des Faltstuhls blieb, als die Funktion schon vergessen war: die gekreuzten Beine der Pseudofaltstühle des 16. Jahrhunderts sind fest vernietet. In den Wohnungen dieser Zeit, seit der Renaissance größer geworden, war raumsparendes Zusammenklappen der Stühle nicht mehr notwendig.
Ebenso formprägend – wie beim Faltstuhl der Wunsch nach Beweglichkeit – war und ist für alle Stühle das uralte Bedürfnis des Menschen, die Gegenstände seines täglichen Gebrauchs zu schmücken. Schmuckformen, Dekors zieren die frühesten Stühle schon, sie sind Ausdruck früher Individualität: der Besitzer schmückte, schnitzte seinen Stuhl selber. Dieser Wunsch nach eigenem Gepräge der Möbel hielt sich über Jahrhunderte, Jahrtausende: der Bauer, der handwerkliche Fertigkeit am längsten bewahrte, schuf noch im 19. Jahrhundert reich geschnitzte, teils mit Intarsien prächtig geschmückte Stühle und Schränke. Heinrich Heine berichtet von seiner Harzreise: „So stillstehend ruhig das Leben dieser Leute erscheint, so ist es dennoch ein wahrhaftes, lebendiges Leben. Die steinalte zitternde Frau, die, dem großen Schrank gegenüber, hinterm Ofen saß, mag dort schon ein Vierteljahrhundert lang gesessen haben, und ihr Denken und Fühlen ist gewiss innig verwachsen mit allen Ecken dieses Ofens und allen Schnitzereien dieses Schrankes. Und Schrank und Ofen leben, denn ein Mensch hat ihnen einen Teil seiner Seele eingeflößt ... Sinnigem, harmlosem Volke in der stillen, umfriedeten Heimatlichkeit seiner niederen Berg- und Waldhütten offenbarte sich das innere Leben solcher Gegenstände.“ Als dann, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der Einfluss der Stadt aufs Land drang – unter anderem durch die vermittelnde Funktion der Eisenbahn und die Land-Sehnsucht des romantischen Städters – verlor auch der Bauer die inneren Kräfte, die ihn getrieben hatten, seine Möbel zu schmücken: der Bauer legte seine Tracht ab und kleidete sich wie der Städter, er richtete einen Salon ein, während die bürgerliche Villa ihre Bauernstube bekam, er kaufte Plüsch, während Museumsgründer von Dorf zu Dorf zogen, um urwüchsige Bauernmöbel zu sammeln. Selbstgebastelte Schränke bemalte der Bauer nun mit städtischen, mit architektonischen Motiven, mit Rokoko-Säulchen. Der Schmuck, Ausdruck der Individualität des Einzelnen oder der Gemeinschaft, wurde zur Äußerlichkeit, zum Auf-geklebten, zum Kitsch – wie das maschinell hergestellte Ornament. Der Schmuck hatte seine ursprüngliche Funktion, seine formprägende Kraft verloren.
Freilich, diese Kraft war von Anfang an nur sekundär formprägend. Die Schmuckform des Stuhles hing ab von der jeweiligen Grundform, bedingt durch Material, Werkzeug und technische Kenntnis. Sprossen- und Brettstuhl – die frühen Formen des Stuhls – ließen das Flächenornament nicht zu. Das vegetabile Ornament der Gotik, das Groteskornament der Renaissance aber brauchte die Fläche, brauchte den Zargenstuhl, brauchte Möbel aus Rahmenwerk und Füllung, die Werkzeug und handwerkliche Fertigkeit erst im 13., 14. Jahrhundert entstehen ließen: 1322 wird zum ersten Mal ein Sägewerk erwähnt, in Augsburg.
Sprossen- und Brettstuhl – der eine im Norden Europas, der andere im Süden vorherrschend – waren ideal für die gedrechselte Schmuckform, die geschnitzte Rundform. Die Drehbank – so scheint es – ist nur entstanden, um diesen Wunsch nach Schmuck zu erfüllen: Holz zu drehen war zuerst nicht technische Notwendigkeit; Rundholz konnte auch mit Beil und Schaber her-gestellt werden und wurde es noch lange, als die Drehbank schon erfunden war (bis in die jüngste Zeit wurden die Teile der Sprossenstühle in ländlichen Gegenden von Bauern selbst von Hand behauen). Über Jahrhunderte diente die Drehbank fast ausschließlich dazu, Schmuckformen herzustellen. Sie brachte dem Menschen – wie die Töpferscheibe –vollendet symmetrische, zeitlose Formen: der gedrechselte elfenbeinerne Fuß eines Thronsessels aus dem 7. Jahrhundert vor Christus, im syrischen Sendschirli gefunden, könnte ebenso gut eine Kommode des 18. oder 19. Jahrhunderts getragen haben.
Zunächst weder notwendig für die Holzbearbeitung noch Neues bringend, machte sich die Arbeitstechnik der Drehbank bald selbständig und führte zur ersten Serienfertigung, dreihundert Jahre vor der Zeitenwende: Wer eine Drehbank besaß, konnte mehr Stuhlbeine und Holzgefäße herstellen, als er für sich selbst brauchte, er konnte für andere mitproduzieren, sich einen Beruf schaffen, sich spezialisieren. Schon im dritten und vierten Jahrhundert vor Christus waren Drechsler in allen Provinzen des römischen Reiches vielbeschäftigte Spezialisten, die Möbelfüße und Stuhlbeine in großen Stückzahlen herstellten. Zunächst wohl bauten sie die Stühle noch selbst zusammen, dann aber beschränkten sie sich mehr und mehr auf die Dreharbeit, fertigten in der Serie. Je mehr sie vom ideenreichen, formenden Handwerker zum Hersteller monotoner Serien wurden, je mehr sie die Bindung zum gesamten Möbel verloren, desto mehr schwand ihre einst instinktive Formsicherheit: die Beine etruskischer Liegesofas waren elegant, formspielerisch reich, die Möbelbeine aus römischer Zeit dagegen vereinfacht, plump, klobig. Aus leichten Schwingungen, Schweifungen wurden knollig-kugelige Entartungen, wie man sie tausendfach auch am Stil-Kitsch der Serien-Möbel des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts findet. Die Kinderkrankheiten der ersten Serienfertigung waren mehr als zweitausend Jahre später noch nicht geheilt. Dazwischen aber lagen Höhepunkte handwerklicher Drechselkunst, wie etwa das romanische Chorgestühl in der Benediktiner-Abtei zu Alpirsbach, um 1050 entstanden.
Das ausgehende Mittelalter brachte der Technik der Holzverarbeitung entscheidend Neues: die ersten Sägemühlen lieferten gleichmäßige und dünne Bretter anstelle der bisher verwendeten dicken Bohlen. Das Schreinerhandwerk, das sich eben um diese Zeit vorn Zimmerhandwerk trennte, sich auf Möbelfertigung spezialisierte, nützte die neuen Möglichkeiten: Möbel aus Rahmenwerk und Füllung entstanden; die Möbel wurden leichter, verloren ihre massive Schwere, die zuvor – in der Romanik – nicht nur Wunsch, sondern auch einzige technische Möglichkeit gewesen war. Die Fläche herrschte nun, bot sich an für neue Schmuckformen, für neue Dekors. Unter den Sitzmöbeln stand der Zargenstuhl im Vordergrund; unter allen Stühlen ermöglicht er die vielseitigste Ausbildung: Brettsitz, Polstersitz, Ausflechtung mit Rohr, Bespannung mit Leder, Stoff, Gurten, Schnur, Gestaltung der Rückenlehne durch Sprossen, Polster, Geflecht. Auf dem Skelett des Zargenstuhls baut die an Formen reiche Entwicklung des Stuhlbaus im westlichen Abendland auf.
Zugleich mit den neuen Möglichkeiten der Produktion wuchs im 13., 14. Jahrhundert der entsprechende Bedarf. in den Städten des Mittelalters war eine wohlhabende Bürgerschicht entstanden, deren Wohnansprüche stiegen. Die häusliche, private Sphäre wurde intimer: Blumen – schon einmal Liebhaberei der etruskischen Weiblichkeit – eroberten die Wohnung; Kännchen, Leuchter, Bildchen zierten waagerechte und senkrechte Flächen; Vögel, Katzen und Hunde teilten das Zimmer mit dem Menschen. Eine Blüte bürgerlicher Wohnkultur entstand, die erst im Absolutismus des 17. Jahrhunderts gestört werden sollte.
Das Schreinerhandwerk erlebte nun seinen entscheidenden Aufschwung. Neue Holzarten wurden verarbeitet, die lokale Trennung aber blieb noch: im Norden herrschten Eiche und Ahorn vor, im Süden Tanne, Fichte und Zirbel, in Frankreich das Nussbaumholz, das wenig später, in der Renaissance, in ganz Europa vorherrschend wurde. Die Werkzeuge des gotischen Schreiners zeigt eine Darstellung des heiligen Joseph in seiner Werkstatt auf dem niederländischen Mérode-Altar aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts: Joseph, ganz im Milieu des 15. Jahrhunderts, arbeitet mit Axt, Säge, verschiedenen Bohrern, Hammer, Kneifzange, Nägeln und mit Schneid-und Stemmwerkzeugen. Ein wichtiges Werkzeug aber vergaß der Maler: den Tischlerhobel, der um die Mitte des 14: Jahrhunderts in seiner heutigen Form entstanden war und der für die Feinbearbeitung des Holzes zunehmend wichtiger wurde (der Ebenist des Barock arbeitete mit zwanzig verschiedenen Hobeln!).
Die neue Konstruktion – Rahmenwerk und Füllung – bestimmte das äußere Bild der Möbel, der Stühle, zumindest zu Anfang und im Höhepunkt der Gotik: eines der letzten Beispiele des unbewussten Konstruktivismus, der fast alle früheren Holzarbeiten auszeichnete, und der sich im Wesen vom meisten Gewollt-Konstruktivistischen aus neuerer Zeit unterscheidet: man hatte noch nicht gelernt. sich des technisch Notwendigen zu schämen, die Konstruktion zu kaschieren. Der Konstruktivismus der Gotik war geistreiches Spiel mit den Bauelementen und nicht exhibitionistisches Zur-Schau-Stellen des Innenlebens (wie etwa auf manchen modernen glasbedeckten Tischen aus unserer Zeit, bei denen die Hauptsache, die Tischplatte, zur schamhaft unsichtbar gemachten Nebensache wird, die notwendige Nebensache aber, die Konstruktion des Gestells, zur optischen Hauptsache).
Gegen Ende der Möbel-Gotik brachte eine neue Technik der Holzbearbeitung den Ansatz-punkt für das Unwahre, das optisch Zweideutige: die Kunst des Furnierens. Sie blieb zunächst im Hintergrund, ihre hohe Zeit kam im Barock, in der theatralischen Kulissenwelt der bürger-lichen Wohnung des 17. Jahrhunderts. Die Renaissance, schaufreudig, weltlich, das Äußere betonend, hatte vorgewirkt: die Möbel des 16. Jahrhunderts schon hatten prächtige Vordersei-ten, aber ärmliche Seitenwände. Das Barock brachte zum ersten Mal die bewusste Täuschung, die künstliche Verfremdung des Materials Holz: Ahorn wurde mit Spinatwasser grün gefärbt, frisches Eichenholz mit Ammoniak auf alt getönt. (Ein Grund für die Manipulationen mit dem Holz war, neben anderem, das Entstehen der Möbelgarnitur: bis zum Mittelalter und noch in der Renaissance wurden verschiedenartige Möbelstücke im Zimmer zusammengestellt, im Barock mussten die einzelnen Stücke in Material und Farben zusammenpassen). Holz wurde mit fremdem Material – Elfenbein, Schildpatt, Zinn, Horn – beklebt, die Umrisse der Möbel – schon in der Spätgotik zerrissen, in der Renaissance noch einmal gefangen zu architektonisch klarer Form – neigten nun zum Bizarren, Grotesken. Wo möglich, wurde das Holz, das den wilden Formen nicht folgen konnte, durch anderes Material ersetzt: die Zimmerdecken, in Gotik und Renaissance aus Holz, krümmten sich nun in Gips. Marmor dagegen wurde in Holz imitiert. Das Materialfremde herrschte.
Nicht, dass das Barock zum ersten Mal materialfremde Formen brachte. Auch frühere Zeiten hatten ihre Verirrungen. Ein Beispiel: der Komplex rund um die 4600 Jahre alte Djoser-Pyramide in Sakkara, der – obwohl in dem neuen Material Stein erbaut – noch ganz der Art früherer Lehmziegelbauten entsprach, und bei dem massive Steine so bearbeitet wurden, dass sie älteren Materialien ähnelten: dem Palmstamm oder dem mit Lehm beworfenen Schilfstängel-Bündel. Und zur Zeit des Hans Sachs übertrug man die Metalltechnik auf Gebäudeornamente, dass sie wie aus Stein geschnittenes Blechzeug wirkten.
Aber diese materialfremden Formen hatten ihre Ursachen in mangelnder Erfahrung, in einer Unsicherheit des Gefühls für die Zusammenhänge zwischen Form und Material und nicht – wie im Barock – in der bewussten Täuschung. Hier, im 17. Jahrhundert, verlangte ein rasch reich gewordenes, zum Luxus drängendes Publikum nach äußerlicher Bestätigung: Schon im 16. Jahrhundert begannen Bürger und Bauern, mit den Lebensgewohnheiten höherer Stände zu liebäugeln, zunächst im Süddeutschen, wo gemilderte Leibeigenschaft und gewisse politische Freiheit die Bildung von Reichtum gefördert hatten: „Die Bauern wollen nicht vertragen, dass die Ritter und ihr Kind anders denn sie gekleidet sind“, heißt es in einem Nürnberger Fastnachtsspiel aus dieser Zeit. Und nicht zu vergessen: In der Zeit zwischen Renaissance und Barock wurde Europa von Kriegen heimgesucht. Die Luxus-Sucht des 17. Jahrhunderts wurzelte nicht zuletzt im Dreißigjährigen Krieg. Der Verlust des Weltbildes, des eigenen Standpunktes, ließ den Menschen um die Mitte des 17. Jahrhunderts willig nach fremdartigen Formen greifen, machte ihn exotischen Einflüssen zugänglich: Nach dem Dreißigjährigen Krieg entwickelte sich in Europa eine China-Mode; Chinoiserien, echt und unecht, grassierten. (Eigenartig, dass in unseren Tagen neben pseudoasketischen, tektonisch-nackten Gerippeformen ebenfalls Exotismen ihre Blüten treiben: Schulen lehren lkebana, die japanische Kunst des Blumen-Arrangements, Kamelsättel, indische Metallarbeiten, afrikanische Naturplastiken, seriengefertigte Buddhafiguren und marokkanische Sitzkissen haben Hochkonjunktur).
Das Schreinerhandwerk differenzierte, spezialisierte sich im 17. und beginnenden 18. Jahrhundert weiter, trieb handwerkliche Fertigkeit auf die Spitze, ehe die Gewerbefreiheit – 1791 in Frankreich, 1868 in Deutschland eingeführt – die große Krise brachte. Der Möbelkünstler dieser Zeit verwendete alle greifbaren, brauchbaren Holzarten: Eiche, Nussbaum, Birnbaum, Pflaumenbaum, Stechpalme, Ebenholz, Mandelbaum, Rosenholz, Tulpenholz, Silberpappel, Satinholz, Zitronenbaum, Guajakhölzer, Sandelholz, Palisander, Eibenwurzeln, das amerika-nische Fustikholz, das asiatische wohlriechende Padoukholz und das prächtige Mahagoni, das um 1750 über Bordeaux nach Paris gelangt war. David Roentgen, „le plus célèbre ébéniste de l‘Europe“, war der unbestrittene Meister unter den Holzkünstlern. In unerreichter Technik tönte er die Hölzer, erzielte Schattierungen feinster Nuancen und legte mit kleinsten, in den Tönungen aufeinander abgestimmten Holzteilchen komplette „Gemälde“ in seine Möbel ein: zum Äußersten verfeinertes Handwerk, zur Spitze getriebene Einzelleistung –am Vorabend der Krise des Handwerks, am Vorabend der industriellen Fertigung.
Schon die berühmten englischen Stuhlmacher des 18. Jahrhunderts, Chippendale, Sheraton, Hepplewhite, arbeiteten nicht mehr nur nach Einzelaufträgen (wie die meisten der stark an den französischen Hof gebundenen Ebenisten), sie produzierten in Serien, verschickten Kataloge. Nur: ihre „Fabriken“ waren potenzierte, in ihrer Kapazität vervielfachte Handwerksbetriebe. Lediglich die Arbeitsteilung entsprach dem Wesen der Serienfertigung, nicht aber das Produkt. Die industrielle Serienfertigung übernahm – statt Neues zu bringen – das handwerkliche Ornament, brachte es in Massen. Die Schmuckform, aus der Freude am Spiel mit dem Material gewachsen, wurde maschinell gefertigt – inhaltslos, funktionslos, unecht, wurde Kitsch: in den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts produzierten die USA massenweise Stühle im „French style“ aus dem neuen Sperrholz.
Die Maschine verlangte andere Verfahren der Holzverarbeitung, als sie der Handwerker über Jahrhunderte gepflegt und entwickelt hatte. Eigenartigerweise greifen die Erfindungen des rheinischen Tischlermeisters Michael Thonet, die entscheidend für die Massenproduktion waren, auf Methoden der Holzbearbeitung zurück, die schon in der Antike bekannt, aber über die Jahrhunderte vom Handwerk nicht weiterentwickelt worden waren: Biegen von Vollholz und Formen von Schichtholz.
6
Vollholz zu biegen, war schon im Altertum bekannt. Zunächst freilich wurde die Biegung der elastischen Holzteile nur durch die Konstruktion gehalten: in der Bogenwaffe, im Korb. Schon früh aber lernte man, feuchtes Holz über dem Feuer zu biegen, so dass es seine neue Form ohne Zwang behielt. Das Verfahren erforderte großes Geschick und brachte mehr Fehlschläge als Erfolge. Das Biegen von Holz blieb deshalb in der handwerklichen Schreinerkunst ein Außenseiter-Verfahren, das nicht verbessert wurde, an das man sich kaum wagte. Selbst als der Zeit-Stil, im Barock etwa, gebogene, geschwungene Linien forderte, fand das Biegen von Holz seinen Meister nicht. Das Handwerk wählte den Ausweg: geschwungene Formen mit kleinem Krümmungsradius wurden aus dem Vollholz herausgesägt – auch ein Beispiel nicht materialgerechter Verarbeitung. Die ausgesägte Krümmung brachte erhebliche Nachteile, vor allem verringerte mechanische Festigkeit. Wilhelm von Kügelgen bekam 1847 einen „modernen Lehnstuhl“ geschenkt und beklagte sich über mancherlei Mängel: „... überdies brachen gleich die Vorderbeine ab, als ich mich daraufsetzte, weil sie so geschweift und gebogen sind, dass sie notwendigerweise brechen mussten, und geleimt können sie gar nicht wieder werden. So muss dieser Stuhl zeitlebens ein Krüppel bleiben, oder ich muss ihm für viel Geld neue Beine machen lassen“. Dieses materialverschwendende spanabhebende Verformen von Holz war ungeeignet für die Massenproduktion. (Heute werden auf der Welt jährlich über 1,5 Milliarden Kubikmeter Nutz- und Brennholz eingeschlagen. Allein die holzverarbeitende Industrie der Bundesrepublik verbrauchte 1959 für rund zwei Milliarden Mark Hölzer aller Art: eine Materialeinsparung von nur fünf Prozent bedeutet also bereits einen Gewinn von rund 100 Millionen Mark).
Michael Thonet fand ein neues Verfahren, Vollholz zu biegen und gab der Massenproduktion von Stühlen den entscheidenden Impuls: er spannte Hölzer in eine Stahlform und bog beides im Wasserdampf. Der Effekt: das Holz wurde nicht mehr gestreckt, sondern gestaucht; die Ausschussquote war gering. Das Buchenholz, das während des Biegens im Wasserdampf seine ursprüngliche Festigkeit verliert, erhält Zähigkeit und Elastizität nach dem Erkalten wieder zurück. So können genormte Bauelemente, Standardformen, auf Vorrat produziert und anschließend von angelernten Serienarbeitern – zum fertigen Stuhl zusammengesetzt werden.
Der Bugholzstuhl war das erste seriengerechte Möbel; er blieb über Jahrzehnte das einzige. Überdies ist er nicht nur das klassische Beispiel des Serienstuhls: er belegt auch den Geschmackswandel während der letzten hundert Jahre. Seine Form, durch Konstruktion und Herstellung bestimmt, bietet dem Ornament, dem Schmuck nur wenig Raum. Der Bugholzstuhl ist alles andere als repräsentativ. Er blieb denn auch ein halbes Jahrhundert und länger aus der guten Stube des Bürgers verbannt; dort herrschten „die Zimmereinrichtung“, die Plüschgarnitur, die unbequemen, aber repräsentativen Stühle mit gerader, hoher, steiler Lehne. Der Bugholzstuhl war der Stuhl für den täglichen, den werktäglichen Gebrauch. Erst nach 1920 wurden die technisch reinen, klaren, sauberen Formen dieses Serienstuhls „entdeckt“: Le Corbusier, Mart Stam und andere stellten ihn in ihre Musterwohnungen der Weißenhofsiedlung in Stuttgart. Heute zählen die lange verachteten Bugholzstühle zu den Archetypen der modernen Formen.
Neben dem Formbiegen entspricht das Formpressen den besonderen Bedingungen der Serien-fertigung. Die ersten Versuche, Holzflächen in zwei oder drei Dimensionen zu verformen, scheiterten im 19. Jahrhundert: Man versuchte, Sperrholz oder aus Furnieren parallel-faserig geschichtetes Holz wie Metall tiefzuziehen. Dem Holz aber mangelt eine Eigenschaft, die bei Eisen stark ausgeprägt ist: die Fähigkeit, unter Druck zu fließen. Holz bricht nach geringer elastischer Dehnung unvermittelt. (Besondere Eigenschaften des Schichtholzes waren übrigens ebenfalls im Altertum schon bekannt: die Hyksos, die um 1700 vor Christus zeitweilig Ägypten beherrschten, verdankten ihre überraschenden Kampferfolge ihren Bogen aus zusammengeleimten Holzschichten mit Sehnen und Horn, die wesentlich größere Schussweiten erzielten als die Bogen der Ägypter.
Ein geeignetes Arbeitsverfahren musste den Mangel des Holzes – das Nichtfließen bei der Verformung umgehen. Schon Thonet leimte dicke Furniere in Holzform zusammen und presste sie in die gewünschte Form.
Dieses Verfahren – Holz in Furniere zu schälen und diese mit einem Bindemittel unter Druck und Wärme zu einem Material mit neuen Eigenschaften zusammenzufügen – wurde so weiterentwickelt, dass sich dreidimensionale Holzformteile herstellen lassen. Die Furniere werden dabei, je nach den gewünschten mechanischen Eigenschaften des Endprodukts, mit ihren Fasern parallel, senkrecht oder in einem bestimmten Winkel zueinander zusammengelegt. Auch die formgepressten Holzteile lassen sich – wie die Bugholzteile – in Standard-Bauelementen auf Vorrat fabrizieren und in Serien zum kompletten Gerät zusammenbauen. Sie sind in hohem Maße bruchfest und elastisch.
Bughölzer und geformte Holzteile, speziell für die große Serie geeignet, bringen der Produktion – nach Kollmann – bedeutende Vorteile:
– Im Gegensatz zur Herstellung geschwungener Formen durch span-gebende Werkzeuge, die hohe Schnittverluste mit sich bringen, ist die Verformung verlustlos und entlastet damit die Holzbilanz.
– Besonders bei den knappen und wertvollen Hölzern, die meist für geschwungene Formen verwendet werden, macht sich die Materialersparnis bemerkbar.
– Die Herstellung durch Biegen ist in der Regel einfacher und rascher als die mit den üblichen spanabhebenden Holzbearbeitungsmaschinen.
– Der Energieaufwand ist beim Biegen niedriger als beim Zerspanen, gleiche Formgebung vorausgesetzt.
– Die Festigkeit und Steifigkeit gebogener Teile ist bedeutend höher als die ähnlicher, durch Ausschneiden hergestellter Teile. Auch die Oberflächen gebogener Teile sind, einwandfreie Technik vorausgesetzt, meist besser als die gesägter Teile.
– In verschiedenen Fällen, z. B. bei der Herstellung von Sportgeräten, Stock- und Schirmgriffen, Stuhlzargen, Holzringen, Fassdauben usw., kommt technisch und wirtschaftlich nur das Biegen in Frage.
Diese vorteilhaften Verfahren, die sich im wesentlichen von den handwerklichen Bearbeitungsmethoden des Holzes unterscheiden, bestimmten die technischen Daten für den Serienstuhl. Sie setzten keine Grenzen. Schon in der – im Verhältnis zur Entwicklung handwerklicher Stuhlformen – kurzen Zeit serienmäßiger Produktion erweiterten sich die Möglichkeiten ständig: waren zunächst nur Bugholz- und Sprossenstuhl der Serienfertigung gemäß, so kam – spätestens nach dem ersten Weltkrieg – auch der Zargenstuhl dazu. Neue Variationen ermöglichte die Entwicklung des Stahlrohrstuhls: die Gestaltung der Sitzfläche wurde unabhängig von der Konstruktion des Untergestells. Hand in Hand damit ging die Entwicklung des neuen Verfahrens, Sperrholz und Schichtholz dreidimensional zu verformen. Anatomisch geformte, elastische Sitzschalen aus Holz, auf beliebige Untergestelle zu montieren, traten in den Vordergrund. Sie waren, nach den Bugholzteilen, die zweiten von Grund auf seriengemäßen Stuhleinzelteile.
Die neuen Techniken schufen neue Formen, die nur durch Konstruktion, Herstellungsart und Funktion geprägt sind: Konstruktivismus als ehrliches Eingeständnis des Notwendigen, des Gegebenen, des Produktionsgerechten, Funktionalismus als Ergebnis wissenschaftlicher Untersuchung der verschiedenen Arten des Sitzens – beim Lesen, beim Essen, beim Schreiben, im Ruhen. Entartungen ließen nicht auf sich warten: manirierte Primitivismen auf der einen Seite, pseudo-handwerkliche Monumentalformen auf der anderen Seite. Sie hemmten die Entwicklung, aber setzten ihr kein Ende. Das sichere Spiel mit den technischen Möglichkeiten wird neue Formen bringen.
Ausklang
Wer vor 200, 300 Jahren einen Stuhl brauchte – es kam nicht allzu häufig vor – der ging zum Schreiner und bestellte sich einen nach seinen Wünschen, oder er hämmerte das Sitzgerät selber zurecht. Wie immer das Produkt auch ausgefallen sein mochte: in beiden Fällen entsprach es dem, was der Besitzer – hier in des Wortes zweifachem Sinn – sich gewünscht hatte. Der Stuhl gehörte ihm und gehörte zu ihm, und der ihn „besaß“ hatte ein „persönliches“ Verhältnis zu seinem Stuhl. Wer heute einen Stuhl braucht – und es kommt sehr häufig vor – der geht zum Möbelhändler, nennt Preis und Art, und sucht sich unter dem Angebot der Massenproduktion aus, was ihm zusagt. Die Industrie also bestimmt Richtung und Umfang seiner Wünsche. Sie produziert eine Stuhlsorte für Tausende, Zehntausende von Käufern mit Tau-senden, Zehntausenden von Wünschen. Ihr bleiben zwei Möglichkeiten: entweder produziert sie einen Stuhl, der jedem dieser Wünsche zu einem Teil entspricht; das Ergebnis wäre ein Monstrum mit 50 verschiedenen Beinen, in Chippendale und Stahlrohr, in Louis-seize und Gotik, in Rokoko und Queen Anne, in Eiche, Buche, Fichte, Teak, rund, eckig, gebogen, gerade, kurz, lang, braun, gelb, grün, lila ... – oder sie produziert einen Stuhl, der so „neutral“ ist, dass er möglichst vielen Wünschen – nicht widerspricht. Einige Leute schlossen daraus, der seriengefertigte Stuhl – wolle er nicht heuchlerisch etwas vortäuschen – müsse unpersönlich sein, das Unpersönliche sei geradezu das Wesen des Massenprodukts. Diese Folgerung ist wohl etwas voreilig.
Ein Buch zum Beispiel ist durchaus ein Massenprodukt, und doch kann es – auch der Bestsel-ler eines Mode-Autors – für viele Besitzer einen persönlichen Wert erhalten, der – wenn er sich überhaupt vergleichen lässt – über dem Geldwert liegt (so dass der Besitzer sich nicht ohne Not von seinem Buch trennt). Es liegt also – und das ist wieder ein wesentlicher Unter-schied der Serienfertigung vom Handwerkserzeugnis – nicht am Herstellen, sondern am Benützen, ob ein in Massen produzierter Gegenstand beziehungslos bleibt oder in ein persönliches Verhältnis zu seinem Besitzer tritt. Das Massenprodukt, der seriengefertigte Stuhl, muss also nicht unpersönlich sein, er muss vielmehr neutral sein, aber alle Möglichkeiten der Bindung, des „Persönlichwerdens“ einschließen und offenlassen. (Nur wenn er in der Masse benützt werden soll – bei der „Bestuhlung“ in Sälen usw. – muss der Serienstuhl frei sein von diesen Möglichkeiten. Aber schon beim Bürostuhl, der zwar auch in der Masse, aber über längere Zeit stets von ein und derselben Person benützt wird, ist es zweifelhaft, ob „Unpersönlichkeit“ das Wesentliche des seriengefertigten Sitzmöbels ist.
Um jene gewünschte „Neutralität“ zu erreichen, muss, wer einen Stuhl entwirft, sich frei machen von künstlerischen Ambitionen und modischen Einflüssen, die an eine bestimmte Zeit oder Personengruppe gebunden sind. Er muss sich auf das Wesentliche beschränken, und das sind drei Dinge: eine Sitzfläche, eine Vorrichtung, um diese Sitzfläche in einer bestimmten Höhe zu halten, und eine Vorrichtung, um die „haltlosen“ Körperteile des Sitzenden zu stützen. Diese drei Elemente müssen so miteinander verbunden werden, dass die Aufgabe, dem Menschen einen bequemen Sitz zu bieten, optimal erfüllt wird. Der wichtigste, der aktive Teil der Konstruktion wird dabei von den Maßen des Menschen bestimmt: Höhe und Form von Sitzfläche und Rückenlehne. Die übrigen Größen sind variabel, zum Beispiel Zahl, Stärke, Form der Stuhlbeine, Art und Farbe des Holzes, Art und Form der Verbindung zwischen Sitzfläche und Beinen oder Sitzfläche und Rückenlehne. Und diese variablen Größen entscheiden, ob der seriengefertigte Stuhl werkgerecht „neutral“ oder ob er Kitsch ist. Ausgeschlossen vom Vergleich zwischen Massenprodukt und Einzelerzeugnis war bisher die Frage nach der Qualität. Es wäre voreilig, das Massenprodukt von vornherein für schlechter zu halten. Wir erkennen erst heute, durch die Forschungen der letzten Jahrzehnte, wie wichtig die richtige Form, die richtige Höhe der Sitzfläche, der Rückenlehne eines Stuhles sind. Geringfügige Abweichungen schon können aus einem bequemen Stuhl ein Marterinstrument machen. Was wäre also eher geeignet, dem Stuhl die Gewähr der Bequemlichkeit zu geben, als die Präzisionsmaschine in der Serienfertigung?