Hier ein Beispiel: Die Vorderseite aus dem rororo-Handbuch
In den Taschenbüchern des Rowohlt-Verlags (rororo) sind ab etwa 1962 Anzeigen erschienen, die für die Geldanlage in Pfandbriefen
und Kommunalobligationen warben.
Auftraggeber war der Gemeinschaftsdienst der Boden- und Kommunalkreditinstitute in Köln, dem alle privaten Hypothekenbanken und
öffentlichen Banken angeschlossen waren.
Zuvor waren in Taschenbüchern Anzeigen für Zigaretten oder Autos erschienen, ohne jeden Bezug zum Inhalt der Bücher.
Das Neue an den Pfandbriefanzeigen war, dass sie auf eine Stelle im Buch Bezug nahmen, z. B. eine Aussage aus einem Dialog aufgriffen
und dies als Aufhänger für den Anzeigentext nahmen. Die Vorderseite (rechte Seite im Buch) brachte eine grafisch anspruchsvolle
Illustration zum Buchtext (zu 90 Prozent von der Grafikerin Christa Janik aus Leinfelden-Echterdingen gestaltet). Darunter stand ein kurzer
Text aus höchstens vier oder fünf Wörtern und drei Fortsetzungspunkten, der auf der Rückseite fortgesetzt wurde.
6049: Gutes Deutsch in Schrift und Rede.
Das Werbedeutsch...

Und hier (unten) die Fortsetzung auf der Rückseite:
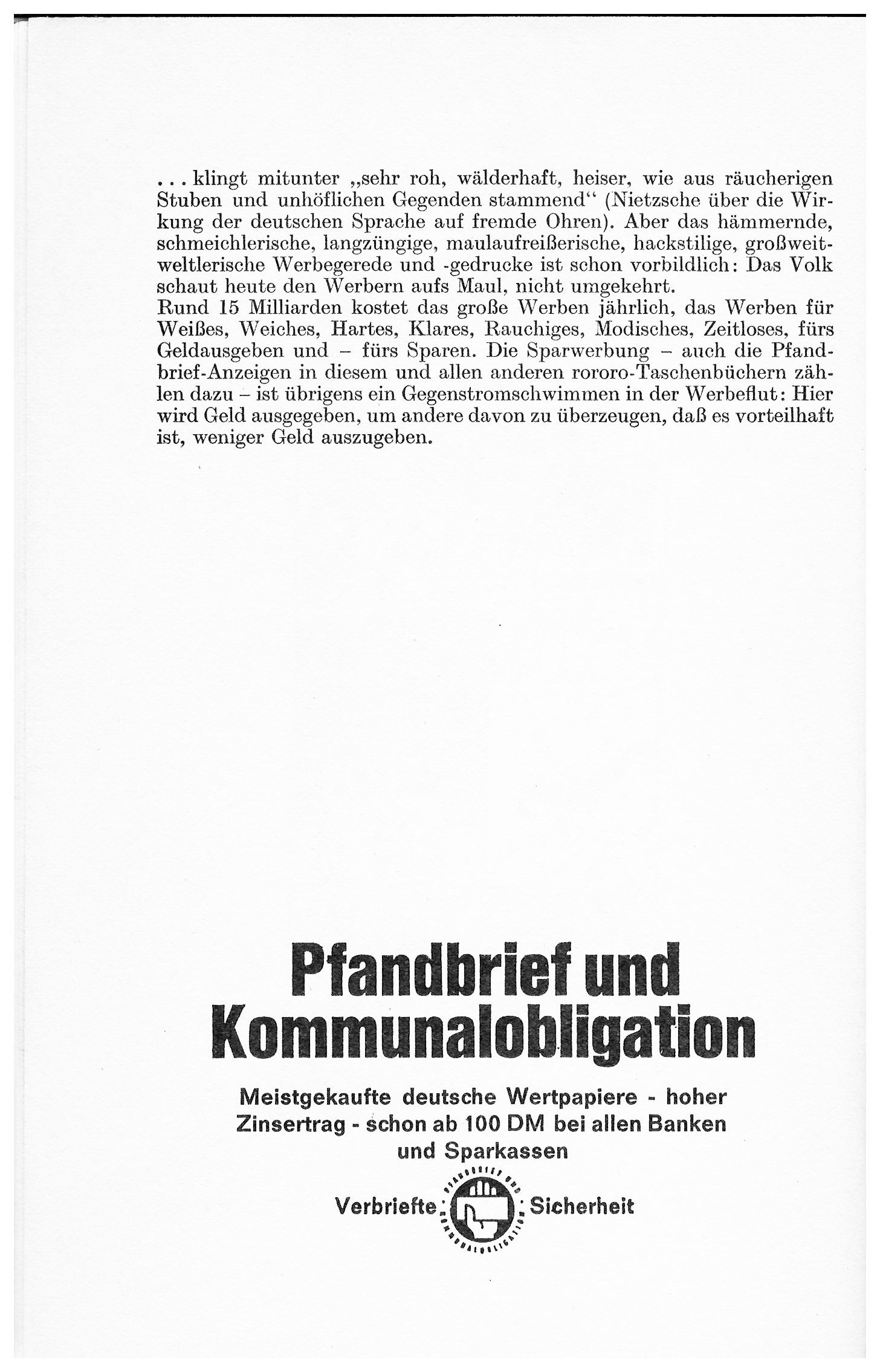
Im Laufe von 12 Jahren
entstanden solche Anzeigen in rund 3.500 verschiedenen Titeln von rororo-Taschenbüchern (Romanen, Sachbüchern, Klassikern usw.).
Weitere Beispiele für Texte aus Pfandbriefanzeigen finden Sie, wenn Sie auf diesen Link klicken
Die Pfandbriefanzeigen wurden mehrfach gelobt. Ein Beispiel:
Am 17. Mai 2003 erschien folgender Text in der österreichischen Tageszeitung „ Die Presse“ (Wien) unter der Rubrik "Zeichen der Zeit":
Geld oder lesen!
20 Jahre lang verkaufte Rowohlt in Taschenbüchern Anzeigen-
seiten für „Pfandbrief und Kommunalobligationen“. Erinnerung
an eine folgenlose Pionierunternehmung.
Von Julia Engelmayer
Sie ist ein echtes Kind ihrer Zeit. Diese eine Werbeseite in den Rowohlt-Taschenbüchern. Jahrzehntelang unerlässlich und heute zweifach
anachronistisch, nur als Flohmarktware oder Zweifel erregende Zukunftsvision denkbar. Bücher, insbesondere literarische Bücher gelten wieder
als werberesistente Medien. Den Werbern sind sie zu leise und ihren Lesern zu heilig.
In den Fünfzigerjahren aber fand im Spannungsfeld zwischen Kultur und Kommerz eine Bewegung statt, die die regelmäßige Werbeseite
als kulturellen Fortschritt auswies. Denn Werbung wurde zur Bedingung einer bahnbrechenden Neuerung.
Billige Qualitätsliteratur war bis 1950 ein Widerspruch in sich. Was gut war, musste teuer sein. Am 17. Juni 1950 erschien dann das erste
deutschsprachige Taschenbuch, hergestellt in dem aus den USA importierten Rotationsverfahren, und machte einer breiten Masse, deren
Bibliotheken oft zerstört waren, gute Literatur endlich zugänglich. Während konservative Kritiker noch einen „Verschleiß der geistigen Güter“
wähnten, freute sich die Leserschaft über günstige Ladenpreise. Nur auf Grund der hohen Auflage, der geringen Werbekosten (die Titelwaren
ja weithin bekannt) und eben der Aufnahme von Werbeseiten konnte so kalkuliert werden.
Die ersten einzelnen Reklamen bewarben Autoreifen, Benzin und Zigaretten. Anfang der Sechzigerjahre entwickelte sich dann die längste,
konzeptionell interessanteste Werbeschaltung der deutschsprachigen Literaturgeschichte, die Anzeigenkampagne für „Pfandbrief und
Kommunalobligation“. Der „Gemeinschaftsdienst der privaten und öffentlich-rechtlichen Hypothekenbanken“ arbeitete an einer langjährigen Vertrauenswerbung
seiner Geldanlageprodukte und fand mit Rowohlts fortschrittlichen Klassikern das ideale Trägermedium. Produktionsleitung und „Gemeinschaftsdienst“
einigten sich auf ein Kampagnenkonzept, das ein Anzeigenblatt pro Taschenbuch vorsah, das beliebig platziert werden durfte. Ein kurzer Satz auf
einer rechten Seite lotste den Leser in den Werbetext auf der umliegenden Seite. Dieser nahm inhaltlich und stilistisch auf den literarischen Text Bezug
und brachte ihn auf den entscheidenden Punkt: Geld!
Die gemeinsame Sprache war nicht mehr das Trennende, sondern schlug einen Übergang in das andere Terrain. Und weil die Anlageform
im Allgemeinen beworben wurde und in den Anzeigen nicht das Logo des Gemeinschaftsdienstes aufschien, wurde eine Untiefe umschifft, der
manche auflaufen, die in hochkulturellen Gewässern fischen fahren: Wenn Werbung in und auf Kulturgütern als aufdringlich und eben unkultiviert
empfunden wird, dann ist die Teilhabe am feinen Kultur-Image den Bach hinunter.
Geschrieben wurden die Anzeigen von dem Journalisten Claus Grupp. Grupp war als Pressereferent zum „Gemeinschaftsdienst“ gekommen und
bereits an der Konzeption der Anzeigenkampagne beteiligt gewesen. Mit Beginn der Zusammenarbeit mit Rowohlt wurde er freier Texter. Der Verlag
schickte die Bücher, Claus Grupp und seine Frau lasen quer, suchten Anknüpfungspunkte und schickten die Stellenangabe an die Grafikerin
Christa Janik. Grupps Oeuvre als Werbetexter umfasst nach eigenen Angaben knapp 4000 Anzeigen. Also 8000 Rowohlttaschenbuchseiten voller
Geldvokabeln. Im September 1970 würdigte die „Zeit" diesen Sprachschatz mit einem halbseitigen Text, der aus Zitaten der Pfandbriefanzeigen
bestand und kommentarlos Grupps Texte zum Artefakt erklärte.
20 Jahre lang, von 1963 bis 1983, waren die Anzeigen in allen rororo-Taschenbüchern enthalten. Über all die Jahre hin blieben sie konzeptionell
gleich. Zu Beginn, so Grupp, seien die Bankdirektoren skeptisch gewesen, ob man das dürfe, für Geldanlagen in Büchern werben. Nur das
Verlagsargument habe sie überzeugt: Man könne dadurch den Lesern Bücher zu diesen Preisen anbieten. Nach 20 Jahren gelangte man dann zu
der Überzeugung, dass der Wert in keinem Verhältnis mehr zum Aufwand stand. Als der Geschäftsführer des „Gemeinschaftsdienstes“ diesen verließ,
endete die Zusammenarbeit mit Rowohlt.
Der Verlag fand keinen Nachfolger, und kein anderer Verlag fand einen. Oft wird auf die Bedeutung der Werbesprache hingewiesen. Manchmal
davon erzählt, dass viele Schriftsteller selbst Werbetexter gewesen seien - wie der Maggi-Dichter Frank Wedekind, der Steyr-Werber Bertolt Brecht
oder der BMW-Autor Hans Magnus Enzensberger. Und es gehört gewusst, dass der bekannteste Satz des Schriftstellers Wolf Haas der Werbespruch
für Öl ist. Die Tatsache, dass wir das für kurios halten, zeigt gerade die heutige Distanz der beiden Sparten.
Nur das Ausrufezeichen ist das gleiche geblieben, für viele Verlage, leider: Geld!
(Ende)
Hinweis:
Im obigen Text wird ein Beitrag aus der Wochenzeitschrift „ZEIT“ erwähnt. Hier ist dieser Text
aus ZEIT Nr. 36 vom 4. September 1970, Seite 16:
Anmerkung: Der folgende Text besteht vollständig aus Teilen von Pfandbriefanzeigen.
Heino Griem:
2000 gemischte Buchstaben
Geld in der Literatur,
das ist ein Kapitel für sich
Eine Trommel
ist kein Ersatz
für ein Klavier
Theorie und Praxis
oder: Von der Variationsbreite
des Begriffes Sparen
Spekulation heißt Nachdenken, Valutaspekulation: tiefes Nachdenken über das Geld. Ich glaube keineswegs, etwas meiner Feder Unwürdiges
zu tun, indem ich hier die Sorge für die Erhaltung des erworbenen und ererbten Vermögens anempfehle.
Der Mensch hat von sich selbst entdeckt, daß er eigentlich gar nicht zum Leben tauge. Nur vermittels etlicher Kunstgriffe war der Mensch bisher
dem Schicksal der Saurier entkommen. Spielerisch lernten die kleinen antiken Griechen das Sparen. Die besonders rigoros durch die
Reinlichkeitserziehung unterdrückte Defäkationslust ist ätiologisch u. a. für die Charaktereigenschaft: besonders sparsam.
Sebastianer sein heißt keine Geldsorgen kennen. Ein Zettel mit einer Notiz, die ich notwendig brauche, ist mir ein Wertpapier, ebenso ein Brief, ein
Lesezeichen an einer Stelle, die ich wiederfinden will. Ein Poet verzinset oft einen Gedanken mit fünfzig Procent, oft mit mehr. Man bekommt etwa
2000 gemischte Buchstaben pro Pfennig. Das ist sehr preiswert, verglichen etwa mit den Buchstaben auf einer Briefmarke.
Das Geld!! . ..
Wenn ich Geld hätte, würde ich kaufen. Es ist ein Wunder, daß man überhaupt noch gelegentlich an Geld kommt, wo so viele Leute schon so viel
Geld haben, daß für unsereinen kaum etwas übrig bleibt. Soll man's also klauen?
Das altslawische.„speti“ zum Beispiel bedeutet: Erfolg haben; im Altindischen heißt „sphayate“: (er) gedeiht, wird fett. Ein Wort, zwei Silben, sechs
Buchstaben, welcher Klang! Luftschlösser kosten nichts. Aber auf die Dauer wohnt man schlecht darin. Mit der Zeit möchte man das besitzen, von
dem man vorher glaubte, man könnte es haben. Und dazu braucht man Geld. (Paris ist der einzige Ort, wo einer ohne Geld noch leben kann.) Geld
und Macht sind Zwillinge, gehen Hand in Hand:
Er lernt zuletzt, je mehr er spart,
Wie oft sich Sorg mit Reichtum paart.
Ein ehrenwerter Mann macht nicht aus seinem Sparbuch eine Radierung. Das Absurde des menschlichen Daseins zeigt sich auch im Sparen. Die
Sonne und das südliche Meer gleichen manchen Mangel an materiellen Gütern aus. In unseren kühlen Breiten dagegen . . . (Die Ungerechtigkeit
des Klimas, von der Camus spricht.) Könnte man wenigstens – um eine Goethesche Reflexion zu variieren, alle ungenutzten Stunden wie Geld
sparen! Ein Weg zur Lösung dieser Probleme führt zum totalen Wohlfahrtsstaat. Ein anderer ist die Förderung der privaten Vermögensbildung zur
eigenen, selbstverantwortlichen Altersvorsorge. Und plötzlich hat man Zeit ...
All die gesparten Minuten, Stunden, Tage können nun verbraucht werden. Wenn gesparte Zeit nun auch noch Zinsen trüge! „Könnte man die Zeit
wie bares Geld beiseite legen, ohne sie zu benutzen.. .“, wünschte sich schon Goethe.
(Um die Unsicherheit aufzuheben, die aus der Ungewißheit vor der Zukunft entsteht, genügt es oft schon, Geld aufzuheben.)
Kunst und Kapital vereinen sich oft, aber selten Künstler und Kapital. Unverändert ist die Situation des Schriftstellers insoweit, als er für die Freiheit
zum Schreiben und Handeln eine gewisse Freiheit von materieller Bedrängnis benötigt.
„Der Reichtum“ zählt selbstverständlich zu den Lastern, weil der Reiche nun mal, wie Jedermann, ein „prächtiger Schwelger und Weinzecher, ein
Buhl, Verführer und Ehebrecher, Witwen und Waisen Guts Verprasser, ein Unterdrücker, Neider und Hasser“ ist, und der Teufel frohlockt, denn
„des Satans Fangnetz in der Welt hat keinen andernNam als Geld“. Man ersehe daraus eine feine Verbindung zwischen der Welt der Finanzen
und dem Mysteriösen, möge daraus aber nicht schließen, daß Geld in jedem Falle etwas Unheimliches an sich hat.
(In Spanien findet man heute noch Geldbüchsen in der Form der weiblichen Brust.)
Die ZEIT schrieb dazu:
Diese Texte und Collagen sind die ersten Veröffentlichungen des jungen Hamburgers Heino Griem.
Die ZEIT hat nicht erwähnt, dass der Text vollständig aus Teilen von Pfandbriefanzeigen besteht.
Hier zwei weitere Beispiele für ein Lob der Pfandbriefanzeigen aus dem Internet(bitte auf den Link klicken):
www.superlupo-magazin.de/viewtopic.php?f=8&t=1545#p32145
shhhhh.twoday.net/stories/werbung-im-buch/
Und wie gesagt: Weitere Texte aus Pfandbriefanzeigen finden Sie, wenn Sie auf diesen Link klicken.
Datenschutz
.